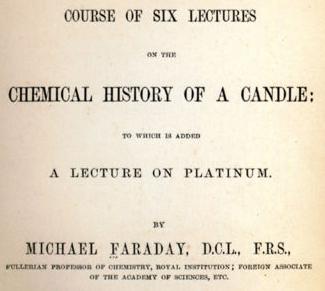Jede Woche (meist zum Wochenende hin) sollen an dieser Stelle einige Highlights
des kommenden Bundeskongresses und Informationen über Bielefeld und
Umgebung vorgestellt werden -
soweit möglich thematisch gebündelt.
|
Rotkohl wird je nach Zubereitung, aber auch je nach Region
Rotkraut oder Blaukraut genannt, die Blattfarbe (meist ein dunkles
Lila) ändert sich entsprechend dem pH-Wert des Bodens
(in sauren Böden erscheint er eher rot,
in alkalischen Böden eher bläulich), und eben auch
entsprechend der Zubereitungsart
- je mehr Essig oder andere Säuren (z. B. durch Äpfel)
beim Kochen dazugeben werden, umso roter ist das Gericht.
|

|
|
Rotkohl ist demnach ein typischer Säure-Base-Indikator
und eignet sich hervorragend für Schüler-Experimente.
|

|
|
| 10 Jahre teutolab Chemie
|
|
Das Bielefelder teutolab Chemie - ein Mitmach- und Experimentierlabor
für Schülerinnen und Schüler -
wurde im Jahr 2000 gegründet. Anläßlich des 10-jährigen
Bestehens fand am 6.Februar in der Halle der Universität
Bielefeld ein spektakuläres
Gemeinschafts-Experimentieren statt:
825 Kinder experimentierten mit gekochtem Rotkohlsaft
(250 Liter wurden verwendet) und Zitronen:
sie erstellten in Reagenzgläsern alle
Regenbogenfarben
(Pressebericht, NW 8.2.2010).
Pro Woche nehmen üblicherweise drei Schulklassen an den Experimenten
des teutolab Chemie teil,
die in eigens dafür eingerichteten Räumen der Universität stattfinden.
Hier eine
Aufstellung einiger der Experimentier-Reihen für Kinder von 8 bis 12:
- Zitrone (I),
- Papier und Tinte,
- Milch
|

|
Für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren gibt es zum Beispiel
- Chemie der Zitrusfrüchte (Zitrone II),
- Regenerative Energieträger,
- Umwelt,
- Chemie & Kosmetik,
- Coffein.
Und für Jugendliche von 17 bis 19 Jahren
werden neuerdings die Serien Nano (Fullerene, Lotus-Effekt, Nanocluster)
und Analytik (Titration, Potentiometrie,
Photometrie) angeboten.
|
|
Die weiteren Teutolabs
|
|
Neben dem teutolab Chemie gibt es an der Bielefelder
Universität weitere teutolabs: für Mathematik, Physik und Robotik
(auf das teutolab Robotik wurde schon im Blickpunkt 2 hingewiesen);
im Herbst 2010 soll ein weiteres teutolab (Bioinformatik) eröffnet werden.
Am Dienstag (30.03.2010) nachmittag
besteht die Möglichkeit, sich über die teutolabs zu informieren.
Tausende Schülerinnen und Schüler haben bisher die
teutolabs besucht, allein etwa 25 000 das teutolab Chemie.
Der Andrang ist groß, die Kapazitäten allerdings
begrenzt. Daher wurde schon 2002 das
teutolab-Netzwerk gegründet:
bisher wurden nach dem Bielefelder Vorbild etwa 40
Netzwerkstützpunkte an Schulen und Bildungseinrichtungen gegründet,
zuerst nur in der Region Ostwestfalen-Lippe, mittlerweile
aber in ganz Deutschland, und sogar in Girone (Spanien), Kairo
(Ägypten) und Shanghai (China).
|
|
Faradays Kerze
|
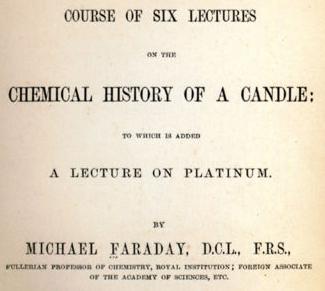 |
Durch spektakuläre, aber eigentlich ganz einfache Experimente Kindern
naturwissenschaftliches Denken nahezubringen, hat eine lange Tradition: berühmt sind
die "Weihnachtsvorträge" Faradays (1791-1867), die später auch
publiziert wurden, in denen er sich Fragen wie den folgenden widmete:
Was brennt denn eigentlich, wenn eine Kerze brennt? Woher kommt das Leuchten? Was bleibt
übrig, wenn sie verbrannt ist?
Und er betonte: Der einfachste Versuch, den man selbst gemacht hat, ist besser als der
schönste, den man sieht.
Wagenschein betonte: Faradays Kerze sollte jeder Lehrer kennen.
Die Workshops CW 30.02 und CW 30.03 von Susanne Wildhirt und Nicole Scholz sind derartigen
Themen gewidmet. Konzipiert sind die Unterrichtsreihen, die dort vorgestellt werden,
als "Lehrstücke"
im Rahmen der sogenannten
Lehrkunst-Bewegung, die
sich auf Comenius, vor allem aber Wagenschein beruft: als durchkomponierte
und mehrfach erprobte Unterrichtseinheiten
zu bedeutsamen Schlüsselerlebnissen, die
variiert und weiterentwickelt werden sollen.
|
|
|
|